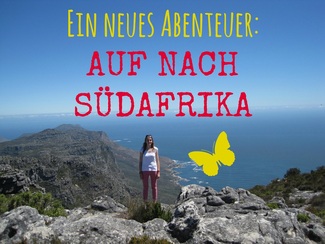 Lisa auf dem Tafelberg (2012).
Lisa auf dem Tafelberg (2012). "Ist es ein gelber Umschlag?"
Der arme Postbote schaut mich verdutzt an. Tatsächlich hält er das lang ersehnte Kuvert aus Berlin in der Hand. "Ein gelber Umschlag!", rufe ich begeistert und er übergibt mir die Sendung mit fragendem Blick.
"Ich gehe nach Südafrika.", sage ich und deute mit der Hand nach oben, "Die Wohnung ist schon gekündigt." Er wünscht mir alles Gute und für einen kurzen Moment sieht er aus, als ob er gerne mitkommen würde.
Zweimal Visum abgelehnt
Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Oben angekommen, reiße ich den Umschlag auf und krame durch die Papierbögen. Ganz unten liegt mein Reisepass - und endlich - nach dem dritten Mal durchblättern entdecke ich den Aufkleber für die Aufenthaltserlaubnis. Erschöpft atme ich auf. Seit Wochen hat sich die Botschaft geweigert mich gehen zu lassen... zweimal wurde der Antrag abgelehnt (vielleicht ein anderes Mal mehr dazu). Beim dritten Mal hat es endlich geklappt.
Alles muss raus
Nun geht es daran, meine Wohnung in Kiel aufzulösen, einen günstigen Flug zu finden, sämtliche Behörden und Versicherungen zu informieren und ungefähr tausend Kleinigkeiten mehr. Darin habe ich zwar schon viel Erfahrung, aber ich vergesse immer wieder, wie nervig die Organisation vor einem Umzug ins Ausland ist. Oder kann man in diesem Fall schon vom Auswandern sprechen? Drei Jahre... so lange habe ich nicht mehr an einem Ort verbracht, seitdem ich die Schule verlassen habe. Mitnehmen kann ich fast nichts. Die Preise für Übergepäck wurden drastisch erhöht, Pakete nach Südafrika sind sehr unsicher zu empfangen. 20 Kilogramm dürfen in meinen Koffer. Manche nehmen 20 kg alleine für einen Wochenendausflug mit. Den Rest muss ich verkaufen oder verschenken, da sich eine Aufbewahrung nicht bezahlt macht.
Ein naher Abschied
Aufgeregt bin ich noch nicht. Das kommt bei mir immer erst am Flughafen. Und ich mache mir Gedanken, ob ich es noch pünktlich bis zur Abreise schaffe alles zu organisieren. Es muss einfach klappen. Bald laufe ich wieder über den sonnigen Campus (so nennt man das Gelände einer Universität), der mir schon so vertraut ist. Auch die Gruppe von Wissenschaftlern, mit denen ich arbeiten werde, kenne ich von meiner Masterarbeit. Es ist also ein bisschen wie "nach Hause kommen". Gleichzeitig werden mich 10.000 Kilometer Luftlinie von Freunden und Familie trennen. Es ist wie in einem Abenteuerfilm, bei dem man den Ausgang nicht kennt. Nur, dass es spannend wird, das weiß man schon am Anfang.
Ich würde euch gerne noch erzählen, woran ich forschen werde, aber dann wird dieser Beitrag endgültig zu lang. Ich werde euch so gut es geht auf dem Laufenden halten und Fotos posten, soweit die Verbindung es zulässt. Ich finde die Idee schön, dass ich euch zu diesem Abenteuer mitnehmen kann. Also, kommt mit mir nach Südafrika!
Viele Grüße, Lisa
P.S: Vermutlich wird der Flug in der letzten Januarwoche liegen. Ich arbeite noch daran^^.








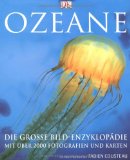
 RSS Feed
RSS Feed
